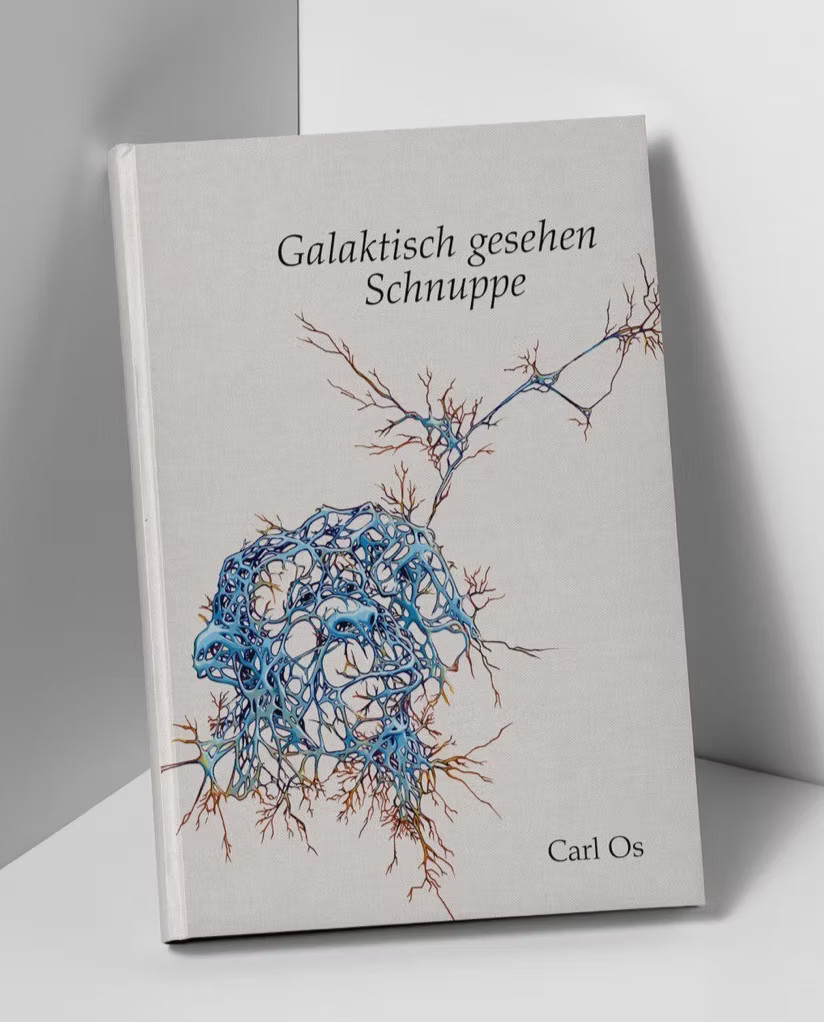Rezensionen
Das 600-Seiten-Werk hat das Zeug zum Kultbuch." Gerhard Summer, Starnberger SZ
Schmutzige neue Welt
SZ Starnberg 17.10.22 von Gerhard SummerHongkong ist evakuiert, Rotterdam hält den Meeresfluten noch stand, um Hamburg steht's so lala. Ja, das Klima
lässt nicht mit sich spaßen, Leute! Venedig ist schon zum Vorort von Peking geworden, Stein für Stein
abgetragen und wieder aufgebaut, und der Untergang von Bangladesch läuft im launigen Frühstücksfernsehen. Das
alles ist nicht so schön, dafür gibt's, wenn das Knie lahmt, Knorpel aus dem 3-D-Drucker.
Der iZoo ist erfunden und auch das iMitat, eine Art ›Bezaubernde Jeannie‹ in Hologramm-Form. Pizzadrohnen
schwirren durch die Luft, Taxis kommen längst ohne Fahrer aus. ›Ungeliftet‹ ist die Bezeichnung
›im Unterhalb‹ das neue Synonym für Armut, wer es sich leisten kann und überleben will, residiert im
europäischen ›Oberhalb‹. Der teuerste Bezirk heißt lustigerweise Null-Acht-Fünfzehn. Und, ach ja: Die
Außerirdischen melden sich. Ist ja auch mal Zeit geworden.
Was sie den Erdenbewohnern mitteilen? Die Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig: Die Botschaft könnte ein Sprachkurs sein oder ein mathematisches Kreuzworträtsel samt physikalischer Formelsammlung. Vielleicht auch nur ein Bluff ?Egal, die Aufregung, die Carl Os in seinem Roman ›Galaktisch gesehen Schnuppe‹ beschreibt, ist natürlich groß. Die vermeintliche Sprache der Aliens wird auf den Namen ›Ursisch‹ getauft, im Internet kursieren bald Wörterbücher, fleißige Übersetzer übertragen sogar die ›Biene Maja‹ ins Ursische.
Wer allmählich beim Lesen stutzt, der stutzt zu Recht. Denn spätestens an dieser Stelle - im Grunde aber von Anfang an fragt man sich, wie es sein kann, dass Carl Os als Autor bislang ein unbeschriebenes Blatt ist und dieses sich vor Fantasie schier überschlagende, witzige, traurige, tiefernste und stilistisch brillante 600-Seiten-Buch sein Erstling sein soll? Denn dem 68-Jährigen gelingt aus dem Stand mitreißende dystopische Literatur. Ein ähnlich fulminantes Debüt hat bisher nur noch ein anderer Musiker aus dem Fünfseenland hingelegt: Anatol Regnier aus Ambach, der 1997 in ›Damals in Belechov‹ das Überleben in Nazi-Zeiten beschrieb.
Carl Os ist ein Pseudonym. Wenn man es zu schnell spricht, klingt es wie Carlos. Im wirklichen Leben heißt der Autor Karl …. Er stammt aus Herne im Ruhrgebiet und ist ein ›Kind der Hippie-Ära‹. Der Gitarrist und Percussionist leitet seit drei Jahrzehnten die von ihm gegründete Herrschinger Musikschule. Und immerhin: Es gibt eine Erklärung dafür, dass dieser Schreiber aus dem Nichts auftaucht: Er gehört offenbar zu den ganz wenigen Schrifstellern in Deutschland, die nicht ahnen, was sie können.
Erst als seine Texte bei Literaturkonzerten ankamen, habe er ein wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gefasst, sagt er. Seinem ersten Roman soll nun ein Kinderbuch über den federleichten Weltraum-Hopser ›Musepit‹ folgen. Außerdem habe er drei Kurzgeschichten fertig in der Schublade liegen und denke über eine Fortsetzung von ›Galaktisch gesehen Schnuppe‹ nach.
Der Herrschinger verfasste schon als Jugendlicher Gedichte und Prosa, sozusagen ›immer nur heimlich‹, wie er vor kurzem in einem Prolog zu einer Lesung in Herrsching erklärte. Mit 30 hatte er schon 13 Bücher geschrieben, diese ›aber nie jemandem gezeigt‹. Er begann, sich für die Zukunft zu interessieren, beschäftigte sich mit skurrilen Glossen über Zeitreisen, entdeckte Trommeln und Afrika und brachte 1996 eine Kurzgeschichte mit dem Titel "Galaktisch gesehen Schnuppe" zu Papier. Damals war er 42 und Vater von zwei Kindern. Aber ›immer nur in den Ferien, im Geheimen‹ wuchs die Kurzgeschichte zu etwas Größerem an. Zur Jahrtausendwende kamen noch seine ›Wal-Texte‹ dazu, ›und so allmählich dämmerte mir, dass ich einen Roman schrieb, dass ich ein Puzzle zusammenfügte‹. Von 2012 an reiste Rellensmann jeden Winter in den Senegal und vollendete dort die Geschichte, ›fernab von Strom und fließend Wasser‹
Ältere Texte auszubauen und miteinander zu kombinieren, und sei es auf dem Mars, ist eine heikle Sache. Doch bei Rellensmann oder Os funktioniert es. Er fügt die Stücke wie ein Komponist zusammen, wobei die kursiv eingefügten ›Memoiren der Wale‹, die einen Nachruf auf die Menschheit anstimmen, nicht zwingend notwendig gewesen wären für seine düstere, mit Illustrationen bebilderte Fiktion. Der Plot des Herrschingers ist raffiniert und kompliziert, er enthüllt ihn erst nach und nach, wie man eine Zwiebel häutet.
Nur so viel: Die Geschichte beginnt 2080 und endet 2088 nach konventioneller Zeitrechnung. Auf der Erde ist
der Kalender allerdings wieder auf Null zurückgestellt worden, seit die Außerirdischen, die womöglich auch
sehr irdisch sind, Funksignale gesendet haben. Man schreibt auf dem blauen Planeten also das Jahr 33 post urs
(nach den Ursianern). Der Molekularbiologe Vau van Vanderbeke überträgt im Auftrag eines mysteriösen
Millionärs merkwürdige Kalendersprüche und Bonmots ins Erbgut von Tieren. Er wählt Kakerlaken, die halten was
aus. Das Honorar ist hoch. Seine Firma namens Proto Luz spielt mit. Sie hofft darauf, neue Märkte zu
erschließen.
Vau muss nur ›oben ohne‹ kommen, wenn er an einem abhörsicheren Wasserfall die Botin Shirin trifft, die ihm
die Texte in gelben Kuverts überreicht: also ohne die Linsen in den Augen, auf die sich alles projizieren
lässt, was das Netz und Google so hergeben. Shirin und Vau kennen sich. Sie haben als Kinder mit ihren Eltern
Urlaub am Strand von Nimbos gemacht. Irgendwann findet Vau, dass auch die schöne Kurierin ihre Reize hat;
seine Frau Simonne, die Gambe spielt und lieber in der Renaissance oder im Barock als im Jahr 33 post urs
leben würde, ist längst eifersüchtig.
Das erledigt sich dann aber von selbst. Inzwischen häufen sich nämlich Anschläge und Todesfälle.
Ein Kongresszentrum in den USA versinkt in Staub und Asche. Ein Taxi-Bot überfährt auch Shirin. Und eine
Cyberattacke trifft das Labor von Proto Luz.
Bald stellt sich heraus: Vau und Shirin waren Geschwister. Die Texte, die sie ihm zusteckte, stammen von
ihrem gemeinsamen Vater Einz. Der Mann hat einen Verdacht: Die Unfälle, das Verschwinden von Städten und
Landschaften in Afrika und die Alien-Nachrichten könnten inszeniert sein - vom Internet, das sich seiner
selbst bewusst geworden ist und seine Überlebenschancen erhöhen will, indem es die Erdbevölkerung ein wenig
dezimiert. Das alles regierende und überwachende ›Myzel‹, wie er es nennt, ist nun mal an die Existenz dieser
Welt gebunden. Und wo ließen sich Einz' Vermutungen, seine ›Como sapiens‹-Notizen, schon besser vor dem Netz
verstecken und weiter vermitteln, als in Kakerlaken-Genen.
Das kann man jetzt für wirr und abgefahren halten. Oder auch für naheliegend und logisch. Möglich sei es,
sagt Karl Rellensmann. Zwei Biologen hätten es ihm bestätigt.
›Galaktisch gesehen Schnuppe‹ hat zwar keine Raumschiffe und nur eine Ahnung von Aliens aufzubieten, könnte
aber trotzdem ein Kultbuch werden. Das hat auch mit seiner cleveren Konstruktion und der stilistischen
Meisterschaft von Carl Os zu tun. Er baut in seinem Roman hundert kleine Storys ein, dreht sie aus elf
Perspektiven Zentimeter für Zentimeter weiter und bewegt sich dabei zwischen etlichen Genres und außerdem
zwischen Ich- Erzählung, Brief, Wal-Predigt und auktorialer Form. Dieser Science-Fiction-Roman ist eine Art
Chamäleon zwischen Buchdeckeln: eine Beziehungs- und Familiengeschichte, vor allem aber auch ein Cyberkrimi,
eine philosophische Abhandlung, ein sich hinwälzender Sermon und eine mal versponnene, mal poetische, mal
sarkastische und brutale Vermessung der Zukunft.
Wenn der Mann der ermordeten Shirin, der Trommler Gos, in die Schlacht gegen die Tax-Bots zieht, geht es fast
zu, wie im ›Herrn der Ringe‹. Denn Gos fügt eine ›Frontlinie von vierundzwanzig Kodotrommlern‹ zusammen, über
denen sich ›in vier Stockwerken der spitz zulaufende Renaissancegiebel von achtzehn brasilianischen Surdos,
zwölf koreanischen Buks und sechs riesigen türmt‹. Dahinter kommt noch eine ›zweistöckige Eskorte von
hundertzwanzig westafrikanischen Djembistas und unzähligen Tambourinen, gewaltig genug, um selbst
achtstöckige Tyrannosaurier mühelos in die Flucht zu schlagen.‹
Dialektik und Abstraktion gehören zu Carl Os' wichtigsten Mitteln. Seine Personen sind fein charakterisiert
und aus Fleisch und Blut, seine Dialoge bei Ehestreitigkeiten prasseln aufs Schönste aufeinander. Meist nimmt
er Sprache ganz wörtlich (›Er geht einem auf den Geist damit. Aber der Geist braucht einen, der auf ihm
geht.‹) Manchmal schreibt er einfach nur flott (›Sein Akzent deutete nach Frankreich, seine Haut nach Afrika,
seine tiefschwarzen Augen mit einem Wink der Brauen ins Wageninnere‹), oft klug (›Ich entdeckte Vau, weil er
mich übersah‹), gelegentlich lyrisch (der frühe Abend: ›wenn die Langeweile die Wolken anhält und das Fenster
ein kniffliges Gemälde rahmt, dessen Konturen die Zeit verdaut.‹). Und immer wieder gelingen ihm wunderbare
Wendungen. Als etwa der schiefe Turm von Pisa in die Luft fliegt fällt dem Autor dazu ein: ›Nicht ein
einziger Mensch würde dabei zu Schaden gekommen sein. Nur die Menschheit.‹
Ja, dieser Roman ist komplex. Er hat zum Ende hin durchaus Längen. Die Einfügungen, die ›Wal‹-Texte und die zunächst aphoristischen Mutmaßungen über ›Myzel‹ und Homo sapiens, ufern oft aus. Und es gibt viele erfundene Begriffe, die man mühsam im Glossar auf den letzten Seiten nachschlagen muss. Aber trotzdem: Diese utopische Menschheitsgeschichte ein großer Wurf.